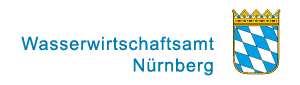Hochwasserereignisse
Hochwasser sind Teil des natürlichen Wasserkreislaufs.
Nicht Menschenhand, sondern die Natur selbst verursacht dieses Phänomen.
Ergiebige Niederschläge, manchmal auch mit Schneeschmelze verbunden, sind Teil des alljährlich wiederkehrenden Wettergeschehens. Hochwasser lassen sich deshalb auch nicht verhindern oder gar abschaffen. So bleibt den Menschen nur die Möglichkeit, dem Fluss seinen Raum zu geben oder mit dem Hochwasserrisiko zu leben.
Katastrophen wie das Hochwasser am Magdalenentag im Jahr 1342 oder das verheerende Hochwasser am Main von 1784 waren Ereignisse, die viele Menschenleben kosteten und riesige Schäden anrichteten.
Die historischen Aufzeichnungen dokumentieren, dass fast jede Generation schmerzhafte Erfahrungen mit Überschwemmungen machte. Dies reicht bis in die Gegenwart.
Die Städte und Gemeinden in Nordmittelfranken blieben von den verheerenden und weiträumigen Katastrophenhochwässern der letzten Jahre zumeist verschont. Das muss nicht so bleiben.
Auch in unserer vergleichsweise niederschlagsarmen Region sind extreme Hochwässer nicht ausgeschlossen, zumal der Klimawandel eine Häufung von extremen Wetterlagen erwarten lässt.
So wurden in den zurückliegenden Jahren die größten Hochwasserereignisse an den Flüssen wie folgt registriert:
- Dezember 1993 Fränkische Rezat
- April 1994 Rednitz
- Januar 1995 Aisch
Historische Hochwasserereignisse
Jahrestag Pfingsthochwasser 1999

Vor 20 Jahren ereignete sich zu Pfingsten ein Hochwasser,
das in weiten Teilen Südbayerns große Schäden verursachte.
Insgesamt waren rund 100.000 Personen betroffen.
-> Mehr Informationen zum Pfingsthochwasser 1999
Das Pfingsthochwasser 1999 jährt sich 2024 zum 25. Mal
Hochwasser sind Naturereignisse, die es immer gab und auch künftig immer geben wird. Nur Historiker werden das vermutlich größte Hochwasser des letzten Jahrtausends aus dem Jahres 1342, das "Magdalenenhochwasser" kennen. Es ist das das vermutlich größte geschichtlich belegte Sommerhochwasser in Mitteleuropa und hinterließ in allen Flussgebieten verheerende Spuren, gestaltete die Landschaft um, vernichtete die gesamte Ernte und löste eine Hungersnot aus.
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre dagegen haben wir noch gut in Erinnerung insbesondere das Pfingsthochwasser 1999. Es war Anlass für die Bayerische Staatsregierung, den Schutz vor Hochwasser stärker als bis dahin voranzutreiben. Dennoch: Schutz hat Grenzen. Daher ist auch jeder Einzelne weiterhin gefordert, sein persönliches Risiko gering zu halten.
Was hat die bayerische Wasserwirtschaft seither unternommen,
um vergleichbare Ereignisse zu vermeiden
Seit 2001 haben der Freistaat Bayern und die Kommunen im Allgäu in einer Vielzahl von Projekten über 250 Mio. € in den Hochwasserschutz investiert. Der Hochwasserschutz für die allermeisten Siedlungsgebiete ist auf dem Stand der Technik.
Wie kann jeder einzelne sein persönliches Risiko verringern
Ausgangs- und Hochwassersituation beim Pfingsthochwasser 1999
Zurück zum Anfang
Das große Hochwasser von 1909

Unter den großen Hochwassern, die die Nürnberger
Geschichte zu verzeichnen hat,
ist das
Hochwasser vom 5. Februar 1909 das mit dem
höchsten Wasserstand.
-> Mehr Informationen zum Hochwasser 1909
Das große Hochwasser von 1909
Erika Scherze
Dipl.-Geol., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg
Unter den großen Hochwassern, die die Nürnberger
Geschichte zu verzeichnen hat, ist das
Hochwasser vom 5. Februar 1909 das mit dem
höchsten Wasserstand. An vielen Stellen der
Altstadt lassen sich die Hochwassermarken finden,
die die damals erreichte Wasserhöhe dokumentieren.
Die beeindruckendste Stelle ist dabei am Eingang
des heutigen Cafes Casa Pane (ehemaliges
Bäumlersches Haus) am Hauptmarkt, wo
die Hochwassermarken vieler Jahrhunderte
wieder angebracht wurden. Für das Hochwasser
von 1909 muss man den Kopf in den Nacken
legen und einen Punkt deutlich über dem
eigenen Kopf anvisieren – so hoch stand damals
das Wasser. Das große Hochwasser bedeckte
den gesamten Hauptmarkt bis über die
Stufen des Schönen Brunnens. Aber nicht nur
der große Marktplatz wurde in einen See verwandelt,
auch alle niedrig gelegenen Straßen
der Altstadt verwandelten sich in reißende Nebenflüsse
der Pegnitz.
Menschen mussten unter schwierigen Bedingungen
zum Teil aus dem ersten Stock ihrer
Häuser gerettet werden. Es wird berichtet von
großen Schäden an Gebäuden und Warenbeständen,
kleinere Stege wurden ganz weggerissen,
wie der Fischersteg an der kleinen Insel
Schütt, größere Brücken wurden durch Kolke
gefährlich unterhöhlt und mussten aufwändig
saniert werden wie die Kanalbrücke in Doos,
aber auch viele Brücken der Innenstadt.
Uns Nachgeborene beschäftigen dabei vor allem
die Fragen: Wie kam es zu dem großen
Hochwasser und könnte das heute wieder passieren?
Wie entstand das große Hochwasser?
Die Analyse zeigt, dass einige Faktoren zusammenwirken
mussten, damit die Pegnitz Hochwasser
dieser Größenordnung führte:
- ein tiefgefrorener Boden
Ab dem 18. Januar 1909 war starker Forst zu
verzeichnen, so dass der Boden bis auf eine
Tiefe von 1 m gefroren war. Dadurch wurden in
der Folgezeit das normale Eindringen des Wasser
in den Boden verhindert und die üblichen
unterirdischen Wasserwege durch den Karstplombiert: Alles Wasser musste an der Oberfläche
abfließen.
- eine stattliche Schneedecke
Ab dem 31. Januar setzten ergiebige Schneefälle
ein, die zu einer dicken durchgehenden Schneedecke (und einem Verkehrschaos) führten.
- ein plötzlicher Wärmeeinbruch
Die Temperaturen, die in den ersten Tagen des
Februars noch weit unter Null lagen, machten vom 2. bis zum 4. Februar einen Sprung in der
Größenordnung von 10 Grad.
- ein starker Regen
Am 3. Februar setzte ein warmer SW-Wind
ein. Der Schneefall ging im Laufe des 4. Februar
in starken Dauerregen über. Dieser drang in die
lockere Schneedecke ein, wurde zunächst von
dieser aufgesogen, löste sie dann aber auf,
und die so verstärkten Wassermassen flossen
zu Tale.
Nachdem der Schnee weitgehend geschmolzen
war, bereitete eine neuerliche Kältewelle ab
dem 6. Februar dem Spuk ein Ende.
Die Hochwasserwelle baut sich
vor den Toren der Stadt auf
In Folge der oben angeführten Umstände begann in den frühen Morgenstunden des 4. Februar
das Wasser im gesamten Einzugsgebiet
der Pegnitz zunächst langsam zu steigen. Die
Pegelstände von Michelfeld, Hohenstadt, Hersbruck,
Lauf, Behringersdorf, Nürnberg (Museumsbrücke)
und Nürnberg (Lederersteg) zeigen
das Auf und Ab der Flutwelle.
Der Michelfelder Pegel (Entfernung nach Nürnberg:104 Flusskilometer) erreichte seinen Höhepunkt am 5. Feb., 4.00 Uhr und der Pegel Hohenstadt (52 km) am 5. Feb. um 14.00 Uhr
nachmittags, zu einem Zeitpunkt also, als in Nürnberg der Wasserstand bereits wieder zu sinken begann. Die Flutwelle der oberen Pegnitz
trug also nicht in vollem Umfang zum
Nürnberger Höchststand bei.
Von entscheidender Bedeutung waren dagegen
die Nebenflüsse im Hersbrucker Raum. Der
Hirschbach, der Högenbach und der Happurgerbach
brachten mit ca. 200 Kubikmetern
fast die Hälfte der Hochwassermenge. Kleinere
Beiträge lieferten noch Sittenbach, Hammerbach,
Schnaittach und mehrere kleine Bäche im
Raum Röthenbach.
Ihren Höchststand erreichten
die Pegel Hersbruck (Entfernung
nach Nürnberg 47
Flusskilometer) am 5. Feb.,
1.00 Uhr nachts und Lauf (26
Flusskilometer) um 4.00 Uhr
nachts und stehen damit in
direktem Zusammenhang mit
dem Höchststand an der
Nürnberger Museumsbrücke
am 5. Feb., 8.00 Uhr.
Während die Flutwellen vor
der Stadt sich langsam aufbauten,
zeigt der Pegel an
der Museumsbrücke einen
Steilanstieg zwischen 4. Feb.,
23.00 Uhr nachts und 5.
Feb., 2.00 Uhr morgens und
rasantes Weitersteigen bis
8.00 Uhr. Die Plötzlichkeit
dieses nächtlichen Ereignisses
traf die Nürnberger wenig
vorbereitet - die aus Hersbruck
und Lauf nach Nürnberg
weitergegebenen Nachrichten
klangen offenbar
nicht allzu dramatisch - und
schlug sich daher in hohen
Sachschäden nieder.
Der Grund für dieses überraschend
schnelle Ansteigen ist
in der topografischen Beschaffenheit
des Pegnitztales
begründet: Die erste Hochwasserwelle
verlief sich in
den breiten Talauen vor der
Stadt mit ihren großen Mäandern,
Altwässern und
Überflutungsflächen. Dies
spiegelt der kontinuierliche
Anstieg des Pegels Behringersdorf
wider. Erst als diese Stauräume aufgefüllt waren und sozusagen
überliefen, raste die Flutwelle auf die Stadt zu.
Die Wassermassen, die viel Platz in den breiten
Talauen gehabt hatten, wurden am Einfluss in
die Stadt in einem Nadelöhr zusammengezwängt
und türmten sich dadurch zu ungeahnter
Höhe. Die Pegnitz verließ ihr durch zahlreiche
Wehre und sonstige Einbauten noch
weiter eingeengtes Bett und ergoss sich in die
Nürnberger Altstadt.
„Mit unheimlicher Schnelligkeit war das Wasser
in den Nachtstunden gestiegen und sperrte
jeglichen Verkehr durch die inneren Stadtteile
ab. Sämtliche Brücken waren unpassierbar geworden.
Gleich einem wilden Strom schoß das
Wasser durch die Straßen.“ Nürnberger Chronik,
März 1909.
Am 6. Februar, als der größte Teil des Schnees
geschmolzen war, setzte wieder Frost ein und
stoppte den Wassernachschub. Der Abfluss gestaltete
sich in der Altstadt schneller als in den
Talauen westlich der Stadt, wie der langsame
Rückgang des Pegels Lederersteg zeigt. Hier
wirkte sich noch der Rückstau an der Dooser
Kanalbrücke aus, die mit ihrer geringen lichten
Weite wie ein Wehr auf die Wassermassen
wirkte.
Die Flut breitet sich in der Stadt aus
Die eintreffende Welle überflutete die tiefer
gelegenen Teile von Wöhrd und füllte die
Wöhrder Wiese auf bis auf eine Höhe von 1,5
m unter der Mauerkrone am Prinzregentenufer.
Die Fränkische Tagespost vom 5.Februar
1909: „Die Wöhrder Wiese gleicht einem großen
breiten Strom von schmutziggelbem Wasser. Dahertreibende Telephonmasten haben sich an Bäumen gefangen und bilden mit anderen
Gegenständen Wehre, über welche die
Wassermassen tosend stürzen.“
Die Wassermassen zwängten sich durch die
Brücken am Marientorgraben, ergossen sich
in den Burggraben, bevor sie durch das Kasemattentor
die Insel(n) Schütt überschwemmten.
Es gab damals noch eine große und eine
kleine Insel Schütt. Der nördlichste Pegnitzarm
wurde im Zug der Flussregulierung zugeschüttet,
auf der früheren kleinen Schütt steht heute
das „Studentenhaus“. „Große Verheerungen
richtete das rasende Element an der Insel
Schütt an, wo es, eingeengt, sich mit elementarer
Gewalt Luft schaffte. Der Fischersteg ist
weggerissen und liegt längs dem Ufer am
Sand, wo die alten malerischen Häuschen in
der Gefahr schweben, von dem schwimmenden
Steg erdrückt zu werden.“ Fränkische Tagespost,
5. Feb. 1909.
Neue Gasse und Tuchergasse verlaufen parallel
zur Pegnitz und wurden deshalb zu Flüssen
umfunktioniert. „Die neue Gasse, die Tucherstraße,
der Spitalplatz sind in reißende Flüsse
verwandelt. In kleinen Häusern steigt man vom
1. Stockfenster bequem in den Rettungskahn…
Am Obstmarkt schaut das Gänsemännchen
ängstlich von seinem Sockel auf einen
großen Wasserspiegel, der, 1 Meter hoch,
immer höher zu steigen droht. Noch 20 m und
das Wasser hat das neue Rathaus erreicht.“
Fränkische Tagespost, 5. Feb. 1909.
Dramatisches ereignet sich auch auf dem südlichen
Pegnitzarm. Hier stand, mitten in den
Fluss gebaut und nur von dem später abgerissenen
Katharinensteg aus erreichbar, das „Gasthaus zur Pegnitz“. Die hier vom Fluss
Eingeschlossenen mussten mit Leitern zum rettenden
Ufer gebracht werden.
„Am unheimlichsten ist's zweifellos in der Spitalgasse
und in der Plobenhofstraße, wo die
Häuser bis zum 1. Stock vollständig unter Wasser
stehen. Aus offenstehenden Oberlichtfenstern
schwimmen Zigarrenkisten, Flaschen usw.
davon…An der Fleischbrücke schießen die
Wasser aus den Läden. Auf der anderen Seite,
beim alten Fleischhaus, ist das Unglück unbeschreiblich.
Von einzelnen
Häusern sieht man kaum
noch den 1. Stock…
Am gewaltigsten sieht der
Hauptmarkt aus: Ein großer
wildbewegter See, dessen
südliche Seite von einem reißenden
Strom durchzogen
wird, alles mit sich nehmend,
was nicht niet- und nagelfest
ist. Um 10 Uhr stand das
Wasser am Schönen Brunnen
schon 40 cm hoch…Vom
Hauptmarkt und von der unteren
Karlsbrücke her schießtdas Wasser in weitem Strudel 1 – 2 Meter hoch
durch die Weintraubengasse auf den Maxplatz“.
Fränkische Tagespost, 5. Feb. 1909.
Rettungs- und Versorgungsmanöver
Die vom Hochwasser eingeschlossenen Menschen
wurden zum Teil in mühseliger und abenteuerlicher
Weise aus ihren Häusern geholt.
Die Feuerwehr leistete Großes in diesen Tagen.
„Der Hausmeister im Amtsgericht an der Karlsbrücke
konnte mit seiner Familie mit knapper
Not vorm Ertrinken gerettet werden. Verzweifelt
stand er auf dem Fenster, nach Hilfe rufend,
während das Wasser immer höher und höher
stieg. Endlich konnte er mit seinen Angehörigen
auf einen Wagen gerettet werden.“ Fränkische
Tagespost, 5. Feb. 1909.
Diejenigen, die in den oberen Stockwerken ihrer
Häuser ausharrten, mussten mit Nahrungsmitteln
versorgt werden. Oft teilten sie ihre Bedürfnisse
auf Papptafeln mit. Seile wurden
über das Wasser gespannt und Pakete mit dem
Nötigsten zu den Eingeschlossenen gezogen.
„Die Bewohner der überschwemmten Stadtteile
sind vielfach ohne hinreichende Nahrung.
Die Feuerwehr bringt nach Kräften Hilfe. Aus
mehreren Häusern wurden Notschüsse abgegeben.“
Fürther General-Anzeiger, 6. Feb.
1909.
Verkehrsprobleme
Schon vor Mitternacht des 4. Februar hatte die
steigende Flut alle Brücken der Altstadt unpassierbar
gemacht. Der Verkehr konnte nur noch
über die höher gelegenen Brücken am Ring
aufrechterhalten werden. Im Überschwemmungsgebiet
selbst waren Kähne ein wichtiges
Fortbewegungs- und vor allem Rettungsmittel.
Sie zu manövrieren erwies sich aber wegen
der starken Strömungen als schwierig. Eine der
ersten Maßnahmen nach dem Hochwasser wardaher, an vielen Stellen in der Stadt eiserne
Ringe anzubringen, durch die ein Seil gezogen
werden sollte, damit die Kähne nicht abtreiben.
Schäden
Mannigfache Schäden richtete das Hochwasser
an. Gerade bei dem ärmeren Teil der Bevölkerung,
der in dem überfluteten Bezirk wohnte,
wurden Hausrat und Wohnungseinrichtungen
unbenutzbar gemacht.
„Schauerlich hat in den engen Gassen und
Gäßchen, dem malerischen Bild Alt-Nürnbergs,
das entfesselte Element gewütet. Entkleidet
von aller Dekoration, heruntergerissen die Gardinen,
die Fenster offen – boten sich die Wohnungen
den Blicken der Vorübergehenden.
Wohnungen? Nein für diese Schlupfwinkel ist
nur das Wort Höhlen angebracht.“ Nürnberger
Chronik, März 1909.
Die Waren, der betroffenen Geschäfte waren
durch das Wasser und vor allem durch den
Schlamm verdorben, wenn sie nicht gleich
weggeschwemmt worden waren. Die noch
halbwegs brauchbaren Reste mussten zu Niedrigpreisen
verschleudert werden. Nicht wenige
Kaufleute und Bewohner der überschwemmten
Bereiche verloren ihre Existenzgrundlage. Häuser wurden baufällig und
mussten aufgestützt und renoviert
werden.
Aus den Straßen waren die
Pflastersteine gerissen worden,
es blieben große Löcher
mit Schmutzlachen. Einen
wesentlichen Anteil an der
Verwüstung hatte auch das
mitgeführte Treibgut, z. B.
dicke Balken, die sich wie Torpedos
in die Einbauten am Fluss gruben. Die
Holzstege in der Altstadt waren weggerissen
und auch die großen Brücken teilweise beschädigt.
„Beim Kasemattentor ist die Holzbrücke
vollständig vernichtet. Auch der Rotschmiedssteg
ist beschädigt. Der Kettensteg
ist durch das angeschwemmte Holz usw. so beschädigt,
daß er wohl neu errichtet werden
muß. Ebenso stark wurde der Steg beim Henkersteg
in Mitleidenschaft gezogen“. Fürther
General-Anzeiger, 6. Feb. 1909.
Alles in allem wird der Schaden, den das Hochwasser
anrichtete, auf über 3 Millionen Reichsmark
geschätzt, eine Zahl, die uns gering vorkommt,
für die damalige Zeit aber, in der ein
Pfund Brot 16 Pfennige kostete, war sie gewaltig.
Hilfsbereitschaft und Spenden
In Anbetracht der Not, die bei den unmittelbaren
Opfern der Flut eingetreten war, entwikkelte
sich eine große Welle von Hilfsbereitschaft. Alle großen Zeitungen veröffentlichten
Spendenaufrufe, denen rege Folge geleistet
wurde. Einzelne Unternehmen starteten Sonderangebote
für die Hochwasseropfer.
Konsequenzen
Die Not und die Schäden, die das Hochwasser
hervorgerufen hatte, hinterließen einen tiefen
Eindruck auch bei den städtischen und staatlichen
Stellen. Bereits 1888 waren Pläne für eine
Verhütung von Überschwemmungen gemacht
worden und in den Schubladen verschwunden.
Diesmal wurde das Geschehen
vom Hydrotechnischen
Bureau in München
gründlich dokumentiert und
bereits 1910 ein umfassender
Plan ausgearbeitet, wie
künftig Hochwasserkatastrophen
zu vermeiden seien. Ein
kleiner Teil dieser Vorschläge
(z. B. die Begradigung der
Pegnitz im Westen) wurde
noch zu Anfang des Jahrhunderts
in die Tat umgesetzt,
der größte Teil der sogenannten
Hochwasserfreilegung (z.
B. die Verbreiterung der Pegnitz
im Altstadtbereich, der
Hochwassertunnel, der
Wöhrder See) erfolgte jedoch
erst nach dem 2. Weltkrieg.
Alles in allem könnte eine
Wassermenge, wie sie 1909
große Teile der Nürnberger
Altstadt verwüstete, heute
ohne Auswirkungen durch
die Stadt hindurch abfließen.
Zurück zum Anfang
Der Hochwasserschutz von Nürnberg

In der Chronik der Stadt Nürnberg wird bereits aus dem Jahre 1342 von einer großen Wasserkatastrophe
berichtet. Bis zum heutigen Tage können seit dieser Zeit etwa 85 mittlere, 45 große und etwa 11 ausgesprochene Katastrophenhochwässer der Pegnitz aufgezählt werden.
-> Mehr Informationen zum Hochwasserschutz von Nürnberg
Der Hochwasserschutz von Nürnberg
Karl-Heinz Isert,
Staatl. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
In der Chronik der Stadt Nürnberg wird bereits
aus dem Jahre 1342 von einer großen Wasserkatastrophe
berichtet. Bis zum heutigen Tage
können seit dieser Zeit etwa 85 mittlere, 45
große und etwa 11 ausgesprochene Katastrophenhochwässer
der Pegnitz aufgezählt werden.
Die Pegnitz mit ihrem Einzugsgebiet von
ca. 1100 km² und einer Normalwasserführung
von 10 m³/s. hatte bei diesen Katastrophenhochwässern
eine Wasserführung von über
300 m³/s.
Ein beträchtlicher Teil der Stadt Nürnberg, insbesondere
ein Großteil der historischen Altstadt,
lag im Überschwemmungsgebiet der
Pegnitz und wurde bei den Katastrophenhochwässern
oft schwer betroffen. So weiß
die Chronik von den schrecklichen Folgen der
Flutwellen zu berichten.
Neben Schäden an den Fluren, Straßen und
Wegen der Stadt Nürnberg stürzten im Jahre
1784 ganze Häuserreihen ein, Brücken wurden
unterkolkt und Stege mit fortgerissen. Nicht
minder schwer war das Hochwasser im Jahre
1849.
Das bedeutendste Hochwasser der jüngeren
Vergangenheit schließlich war das Hochwasser
vom Jahre 1909. Man errechnete, dass dieses
Katastrophenhochwasser 430 m³/s. führte.
Zahlreiche Straßen, insbesondere die tief gelegene
Altstadt, wurde bis zur Höhe des 1. Stockwerkes
der Häuser überschwemmt. Der angerichtete
Schaden ging in die Millionen
Goldmark (1 Goldmark = ca. 3,32 Euro).
Planungen und Entwürfe zum
Hochwasserschutz
Die, wenn auch in weiteren Abständen, wiederkehrenden
großen Überschwemmungskatastrophen
veranlassten den Stadtrat von Nürnberg,
nach dem Hochwasser vom Jahre 1876
durch Prof. Frauenholz in München einen generellen
Entwurf für die Hochwasserfreilegung
der Altstadt ausarbeiten zu lassen.
Schon damals hatte man erkannt, dass die zahlreichen
Triebwerkseinbauten in der Pegnitz mit
den vielen Wasserrädern hemmend auf den
Hochwasserabfluss wirkten. Insbesondere deshalb,
weil die damit verbundenen festen Wehre
ohne Grundablass waren und beim Steigen
des Wasserspiegels kein größerer Durchflussquerschnitt
freizugeben war.
Ebenfalls stellten die vielen Brücken sowie die
niedrigen Bögen des Heilig-Geist-Spitales ein
weiteres Hindernis dar. Schon in diesem ersten
Entwurf war vorgesehen, die den Abfluss behindernden
festen Wehre durch bewegliche
Schützenwehre zu versehen und Flussverbreiterungen
vorzunehmen. Im Bereich des Stadtgebietes
waren solche Verbreiterungen des
Flusslaufes jedoch nicht durchführbar.
Nach dem Hochwasser 1909 wurden die Planungen
zur Durchführung der Hochwasserfreilegung
wieder aufgenommen. Das damalige
Hydrotechnische Bureau in München hatte
in seinem Entwurf vorgesehen, die Hochwässer
der Pegnitz in einem 3-km-Stollen, der unter
dem Burgberg hindurchgeführt werden sollte,abzuführen.
Doch auch dieses Projekt scheiterte
an den hohen Kosten.
Der bayerische Staat aber hatte 1911 immerhin
die Bedeutung der Durchführung der Hochwasserfreilegung
erkannt. Er hatte die Pegnitz
zum Fluss mit erheblicher Hochwassergefahr erklärt
und damit die Aufgabe der Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an der Pegnitz
dem Bezirk Mittelfranken übertragen, der einerseits
wieder mit erheblicher Förderung des
Unternehmens mit staatlichen Mitteln rechnen
konnte.
Der 1. Weltkrieg und die unglücklichen Nachkriegsverhältnisse
aber hatten das Projekt, welches
bereits mit umfangreichen Regulierungsmaßnahmen
bei Nürnberg-Doos und unterhalb
des Lederersteges seinen Anfang nahm, wieder
in Vergessenheit geraten lassen.
Während des letzten Krieges wurde die Altstadt
nahezu vollkommen zerstört. Der Wiederaufbau
der Altstadt erforderte aber mit in erster Linie
auch den Ausbau der Pegnitz, deren Ufer,
Stege, Triebwerk- und Stauanlagen fast restlos
vernichtet waren. Ein Hochwasser in den ersten
Nachkriegsjahren in dem Ausmaße wie 1909
hätte verheerende Auswirkungen gehabt.
So war es gerade die Oberste
Baubehörde in München, die
der Stadt Nürnberg vor dem
Aufbau der Stadtviertel beiderseits
der Pegnitz empfahl,
Maßnahmen zur Hochwasserfreilegung
der Altstadt zu
treffen und wirtschaftlich und
wasserbautechnisch vertretbare
Regulierungsmaßnahmen
auszuarbeiten.
Für die Planer ergaben sich
infolge der Zerstörungen
neue Gesichtspunkte: Da alle
alten Triebwerksanlagen, deren Wehre das
größte Hindernis für die früher geplanten Regulierungsmaßnahmen
bildeten, vernichtet
wurden, waren die Voraussetzungen gegeben,
von dem Projekt des sogenannten Burgbergstollens
abzugehen und das alte Projekt des
Prof. Frauenholz wieder aufzugreifen, welches
für die neuen Projekte manchen Hinweis gab.
Schließlich entstand ein Projekt des Dipl.-Ing.
Hautum und der generelle Entwurf des Hauptamtes
für Tiefbauwesen der Stadt Nürnberg,
der im Jahre 1952 durch die Oberste Baubehörde
im Prinzip genehmigt wurde. Nachdem
in den Jahren 1950 bis 1954 einige Uferschutzbauten
durch das damalige Straßen- und
Flussbauamt Nürnberg ausgeführt wurden,
übernahm 1954 das Wasserwirtschaftsamt
Nürnberg infolge des 1. Gesetzes zur Staatsvereinfachung
die weitere Planung und Bauleitung
für die Hochwasserfreilegung von Nürnberg.
Durchführung der Hochwasserfreilegung
Die Regulierungsmaßnahme erstreckte sich von
der Johannisbrücke bis oberhalb der Steubenbrücke.
Ausgehend von einer festen Sohlenkote
beim Lederersteg sah das Projekt vor, bei
Einhaltung eines Sohlengefälles von 1:1000die Flusssohle zu vertiefen,
das Flussbett auf das hydraulisch
notwendige Profil zu verbreitern
und möglichst alle
störenden Einbauten in der
Pegnitz zu beseitigen. Ferner
waren die erforderlichen
Uferschutzmaßnahmen zu
treffen, um künftige Ausuferungen
und schädliche Uferangriffe
zu vermeiden.
Es war aber auch darauf
Rücksicht zu nehmen, dass
viele der alten Bauten in der
Altstadt auf Pfahlroste gegründet sind, für deren
weitere Erhaltung die Beibehaltung des bisherigen
Grundwasserstandes erforderlich war.
Die Beseitigung der alten Stauanlagen ohne
Errichtung neuer Stauanlagen hätte Nachteile
zur Folge gehabt, die nicht zu übersehen gewesen
wären. Deshalb mussten anstelle der
alten, festen Wehre den Stau selbsttätig haltende,
bewegliche Wehre eingebaut werden.
Die Erhaltung alter, historischer Bauten, wie
Fleischbrücke und Heilig-Geist-Spital, forderte
außerdem noch besondere Baumaßnahmen.
Es mussten die Widerlager
der Bögen des Heilig-Geist-Spitals unterfangen und die
Sohle mit einer Betonsohle
gesichert werden.
Für die Beseitigung der Pegnitzenge
zwischen Fleischbrücke
und Museumsbrücke
waren zwei Lösungen zur
Wahl gestanden. Die in wasserbautechnischer
Hinsicht
günstigere Lösung der Verbreiterung
der Pegnitz in diesem
Bereich mit der Auflage
der Neuerstellung der leischbrücke musste zurücktreten. Um die Fleischbrücke
zu erhalten, wurde die Pegnitzenge
durch den Hochwasserstollenbau umgangen.
Diese Maßnahme kam schließlich im Jahr 1954
durch das Hauptamt für Tiefbauwesen zur Ausführung.
Die Hochwasserfreilegung umfasste
unter anderen folgende wesentlichen
Maßnahmen:
1. Die Erstellung des Weidenmühl-, des Nägelein-,
des Katharinen- und des Bauriedelwehres.
2. Den Bau des Hochwasserstollens, von der
Museumsbrücke bis unterhalb der Fleischbrücke.
3. Den Neubau der Museumsbrücke.
Von den durchgeführten Maßnahmen werden
folgende eingehender beschrieben:
Die Museumsbrücke und der Hochwasserstollen
Die Flussenge zwischen der Fleischbrücke und
der Museumsbrücke verschuldete bei Hochwässern
beträchtliche Rückstauungen. Die
Wassermassen fluteten dann vorwiegend bei
der Großen Insel Schütt über die Ufer. Die Beseitigung
dieser Flussenge war daher eine wesentliche
Maßnahme der Hochwasserfreilegung.
Es standen hier, wie bereits erwähnt,
zwei Vorschläge gegenüber. Dem Wasserbauer
erschien es richtiger, diese Flussenge durch Verbreiterung
der Pegnitz zu beseitigen. Die
Freunde zur Erhaltung der Altstadt jedoch legten
Wert auf das Bestehen der bekannten
Fleischbrücke.
Den verständlichen Wünschen zur Erhaltung alter,
nicht im Kriege zerstörter Bauwerke wurde
Rechnung getragen, indem man von der Museumsbrücke
bis unterhalb der Fleischbrücke einen
Hochwasserstollen erbaute.
Das Hauptamt für Tiefbauwesen
der Stadt Nürnberg
hatte für die Ausführung dieses
Teilprojektes die Planung
und die Bauleitung übernommen.
Der bayerische
Staat und der Bezirk Mittelfranken
haben für diese Maßnahme
Zuschüsse in dem
Umfang gegeben, wie sie für
die sogenannte offene Verbreiterung
auch gewährt
worden wären. Im Zuge dieses Stollenbaues
musste die alte Museumsbrücke abgebrochen
werden. Die neue Brücke, die in Anpassung an
die Verkehrsverhältnisse eine um 9,0 m breitere
Fahrbahn erhielt, spannt sich wieder in zwei
Bögen über die Pegnitz.
Ein dritter Brückenbogen dient als Stollenmund,
der nur vom Heilig-Geist-Spital her gesehen
werden kann.
Der Stollen, der insgesamt 140 m lang ist,
wurde in einer offenen Baugrube als Stahlbetonkonstruktion
erstellt. Seine lichte Höhe beträgt
4,0 m; seine lichte Breite 10,0 m. Die Bemessung
ist so erfolgt, dass der Stollen bebaut
werden kann.
Dieser Bericht des Wasserwirtschaftsamtes
Nürnberg wurde im Wesentlichen gegen Ende
der Fünfziger Jahre verfasst.
Seit der Hochwasserfreilegung, die im Jahr
1962 abgeschlossen wurde, hat es ein Jahrhunderthochwasser
in Nürnberg nicht mehr
gegeben. Die Schutzmaßnahmen konnten deshalb
bis heute (2019) ihre Bewährungsprobe
hinsichtlich der Funktionsfähigkeit noch nicht
unter Beweis stellen.
Zurück zum Anfang